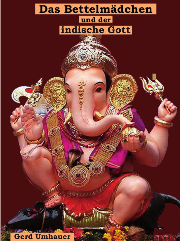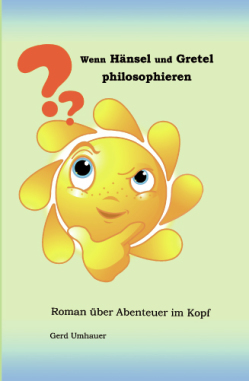Leseproben
Gerd Umhauer
Töten üben
Thriller, 2021,220 Seiten
Zumindest sah er aus wie ein Jogger. Etwa ein Meter sechsundsiebzig groß, schlank. Schwarze Tights, blauschwarze Funktionsjacke, dunkelblaue Asics-Schuhe. Die tief in die Stirn gezogene Baseball-Kappe, Bart und schwarze Brille machten das Gesicht auch bei Helligkeit unkenntlich. Es war ungefähr zehn Minuten nach drei Uhr morgens in einer dunklen Nacht.
Beim Aussteigen legte er die Brille achtlos auf den Beifahrersitz und joggte unendlich langsam die etwa zwei Kilometer zu einem Bauernhaus, in dem Georg Leber eine Zweitwohnung hatte. In einem der Blumenkästen steckte ein Schlüssel, mit dem er unbemerkt in die Parterre-Wohnung gelangte.
Nur die schwarzen Überhandschuhe streifte der Jogger ab und steckte sie in den Hosenbund. Die dünnen Chirurgen-Handschuhe darunter behielt er an. Warten, bis die Augen an die Dunkelheit gewöhnt waren. Alles blieb ruhig. Er kannte sich aus, war schon mal hier. Alles war im ländlichen Stil eingerichtet. Der Holzboden knarrte manchmal.
Die dunkle Gestalt schlich in den Raum hinten links, dessen Türe offen stand. Schon aus zwei Metern Abstand hörte man das unregelmäßige Schnarcheln des Schläfers. Als der Eindringling neben dem Nachttisch stand, vergewisserte er sich, dass die Buddha-Figur noch an ihrem Platz stand.
Zweimal, nur eine halbe Sekunde lang, ließ er den Strahl seiner kugelschreibergroßen Taschenlampe über den Kopf des Schlafenden huschen. Dieser lag auf der Seite und drehte ihm den Rücken zu.
Roboterhaft umfasste er erst mit einer Hand dann mit beiden die Buddha-Figur. Doch als er sie anhob, um sie auf den Kopf des Mannes zu schmettern, schossen blitzlichtartige Erinnerungen durchs Hirn. Es war wie eine grelle Fontäne mit Bildern aus der Kindheit. Der Horror kam zurück. Sekunden-Visionen kannte man ja, aber das war bizarrer. Dieses Monster, das jetzt hier nichtsahnend schlief, stieß alptraumhaft sein ekelerregendes Genital in die Kinder. Hundert-, nein tausendfach. Gleißende Funkenschwaden durchzuckten die Unterleiber. Qualvolle Erinnerungsfetzen im Schnelldurchlauf. Schlimmer als jeder Alptraum. Je größer die Qualen der kleinen Mädchen desto gewaltiger Wut und Genuss, dieses Monster hier zu zermalmen, zu zerquetschen, so dass es siechte, vegetierte, ätzend langsam dem Tod entgegenkroch. Ich werde dich nicht gleich töten, Georg, hallte eine Stimme durchs Hirn, sondern qualvoll dahin vegetieren lassen. Die neonhellen Strahlen im Hirn zogen sich zurück und beendeten die Erstarrung der Arme und Hände. Ruhe kehrte ins Hirn zurück. Sie war wie ein Befehl.
Den Handteller großen Filzsockel der Buddha-Figur ließ die bärtige Gestalt dann wuchtig auf die Schläfe des Schlafenden herunterkrachen. In der nächtlichen Stille machte es ffflaaa. Ein Zucken. Dann der rechte Arm des Schläfers, der sich auf und ab bewegte. Röcheln. Der Versuch sich zu drehen und aufzurichten.
Doch bevor der Mann im Bett es geschafft hatte, folgte der nächste dumpfe Schlag auf seinen Schädel mit noch größerer Wut und Wucht. Augenblicklich sank er in sich zusammen. Man hörte ein leises Gurgeln. Sonst nichts. Der Eindringling leuchtete alles seelenruhig ab, wie um sich zu vergewissern, dass Georg Leber sich nicht mehr rührte.
Vielleicht zwanzig Sekunden später schlich der Jogger genauso leise aus dem Haus wie er gekommen war und deponierte den Schlüssel wieder im Blumenkasten. Den handgroßen Stein, den er in der Seitentasche seiner Funktionsjacke hatte, falls die Buddha-Figur nicht an ihrem Platz gestanden hätte, legte er irgendwo auf der Erde neben dem Holzstapel vor dem Haus ab. Dann zog er die Überhandschuhe wieder an und joggte zu seinem unweit geparkten Auto zurück.
Leseprobe
G. Umhauer
Glücksvernichter
Psychothriller
Angst. Immer diese schreckliche Angst. Stockdunkel. Lähmende Stille. Der Schlaf verfolgt mich. Kann nicht mehr denken. Stehe auf, gehe ans Fenster, um es zu öffnen. Es ist immer noch sehr warm. Traue mich nicht, Licht zu machen. Nur John, der Arzt, meint es gut. Wo ist Marcel? Wo ist Papi? Warum ist mein Mann verschwunden? Oder habe ich geträumt?
Alle drohen, sogar mein Gedächtnis. Die Seele am meisten. Aber sie ist weg. Verschollen wie Papi. So viele Erinnerungen kaputt. Wo ist mein Leben? Fange an zu schlottern. Muss weg hier, sonst stehlen sie mir noch meine Gefühle.
Anziehen in der Dunkelheit. Packe alles in meinen Rucksack. Meine Blätter, wo alles drin steht. Auch John versteht mich nicht. Immer von neuem Fragen aber keine Antworten. Nette Leute, die Daten in Computer tippen.
Alles ist ruhig. Blick auf meine Uhr. Halb vier wahrscheinlich. Nur schwaches Licht vom Hof. Meine Kreditkarte, die in den Socken steckte, hat das Schwein an der Tankstelle nicht gekriegt. Reines Glück, weil mich in New York… Gedanke weg.
Ach ja, die kugelrunde Frau. Sie hat die zwei Typen vertrieben, die über mich herfielen. Danach habe ich die Amex versteckt. Das Geld von meinem Bruder fällt mir ein. Suchen. Es ist in der Hosentasche.
Spähen, ob niemand auf dem Flur ist. Der schwarze Nachtportier schnarcht. Meine Joggingschuhe. Hätte sie beinahe vergessen. Sie haben leise Sohlen. Durchs Fenster sehe ich jetzt ein Stückchen Mond.
In der Toilette, wo Licht ist, trinke ich mit den Händen Wasser. Pinkeln. Nachdenken geht wieder nicht. Was ist nur los mit meinem Kopf? Alles ist durcheinander. Kommt es von den Pillen, die sie mir gegeben haben?
An der frischen Luft wird es sicher besser, überlege ich und schleiche mich aus dem Gebäude. Eine Schwester sieht mich. Ich winke ihr zu, sage „buenas tardes“, weil so viele Mexikaner hier arbeiten.
Bestimmt zwei Kilometer durch das Klinikgelände bis ich endlich an einer Straße bin. Das Gehen tut gut, ich atme und atme. Klar werden im Kopf ist das Wichtigste. Ohne meinen Rucksack wäre ich jetzt gejoggt. Keine Ahnung, wo ich bin. Unwichtig. Muss erst wieder ich selber werden. Ah, doch,. Pomona heißt die Stadt, fällt mir ein, irgendwo in Kalifornien.
Nach mehreren Kilometern eine verwitterte Parkbank. Morgengrauen. Der Verkehr nimmt zu. Schreibe wieder auf, was mit mir passiert. Muss mittendrin eingedöst sein.
Eine Frau weckt mich. Sie fragt auf Spanisch, ob ich irgendwo hin wolle. Indianerin wahrscheinlich. Bronzefarbene Haut, dunkle Augen. Groß, schlank, sehnig, stolz, strenges Haar, ganz schwarz, Zopf.
Ich nicke, weil sie Amanda so ähnelt.
„Señora“, sage ich, „Sie sehen so wunderschön aus wie mein spanisches Kindermädchen Amanda, mit der ich spanisch und englisch reden musste.“
„Sind Sie Französin?“, will sie wissen.
„Deutsch-Italienerin“, sage ich, „mein Bruder lebt hier in Kalifornien, aber mein Gedächtnis ist krank. Ich muss ihn erst suchen. Und mein Notizbuch haben sie mir gestohlen.“
Sie glaubt es nicht, sieht mich eindringlich an. Der Blick tut weh. Plötzlich die Erinnerung, dass ich zweimal überfallen worden bin. Ich sage es der Indianer-Frau, damit sie mir glaubt. „Cell phone, Geldbeutel, Pass und Notizbuch haben die Kerle mir gestohlen, Sen͂ora.“
Gerd Umhauer
Rutschpartie Leben
Kurzgeschichten
Es ist Freitag, 23.40 Uhr. Ich verhalte mich ganz leise, möchte Jost überraschen, wir haben uns heute noch gar nicht gesehen, da er erst heute Morgen, als ich schon außer Haus war, aus Budapest zurück kam.
Felix, Josts Sohn, ist vom Tischtennistraining noch nicht zurück, im Wohnzimmer und Büro ist alles dunkel, nur das Hausflurlicht brennt und die Schlafzimmertüre ist angelehnt.
Unruhig schleiche ich mich durch den Flur, traue mich ahnungsvoll kaum die Türe aufzumachen, als ich das blonde Mädchen sehe, das sich gerade ankleidet. Jost hat nicht einmal eine Unterhose an, murmelt verdutzt „Tamina!“, als er mich sieht
Ich kann nicht einmal sagen, was in mir vorgeht außer Tumult. Es hat mir regelrecht die Sprache verschlagen. Mein Herz pocht wie wild, ich bin zappelig. Dann ohrfeige ich die völlig verblüffte Frau, die mich wie erstarrt ansieht, links und rechts. Sie fällt hin. Am Boden liegend packe ich sie an den langen Haaren und schleife sie durchs Schlafzimmer und den Flur. Sie schreit wie am Spieß.
„Tamina, so sei doch vernünftig“, sagt Jost hinter mir her laufend.
Dann hält er mich an beiden Armen fest. Unwillkürlich wehre ich mich durch einen Ellbogenschlag nach hinten, ohne recht zu wissen, was ich tue. Mein Freund schreit auf und lässt mich los.
Weil ich als Kind so zierlich war, haben mich meine Eltern mit fünf Jahren ins Judotraining geschickt, ab neun oder zehn habe ich dann noch Taekwondo zusätzlich trainiert, beide schwarzen Gürtel erworben, so dass solche Reaktionen eingefleischt sind. Zierlich bin ich immer noch, aber zehn Jahre Kampftechnik verlernt man ebenso wenig wie Schwimmen oder Geige spielen.
Noch ehe Jost sich von dem Schreck erholt, schleife ich die Blondine, die wieder schreit und zetert, vor die Haustüre und knalle sie wütend zu. Jost zieht einen Bademantel und Schuhe an und trägt ihre Kleider hinterher, geht raus zu ihr. Es hat vielleicht 16 Grad.
Dann komme ich erst zum Nachdenken, stehe einen Moment lang unschlüssig herum. Die Aufregung legt sich etwas. Überlegen kann ich trotzdem nicht, handle völlig intuitiv, rufe noch im Stehen meine Omi an, die erst gegen 3 Uhr morgens schlafen geht.
„Omilein, ich bin's, kann ich heute Nacht bei dir schlafen, es ist ein Notfall“, frage ich.
„Aber sicher Kind, kann ich dir irgendwie helfen?“, fragt sie besorgt.
„Nein, ich packe nur schnell ein paar Sachen, in einer Stunde etwa bin ich bei dir.“
Dann kommt Felix aus dem Training zurück, kriegt anscheinend mit, was passiert ist. Im Hausgang umarmt er mich fest, „Vati ist so ein Arschloch“, murmelnd.
„Danke“ sage ich und erwidere die spontane Umarmung. Und plötzlich spielen meine Nerven verrückt. Er sieht meine Tränen, sagt, ich könne heute Nacht in seinem Zimmer schlafen, er lege sich ins Büro.
„Ich gehe zu Omi, Felix, kann nicht hier bleiben“, sage ich weinend.
„Ich komme mit dir!“, erklärt er sofort.
Noch mehr Tränen, Jost kommt wieder herein, schämt sich wahrscheinlich, guckt mich nur kurz an, murmelt „entschuldige Tamina“ und geht dann ins Schlafzimmer, um sich anzuziehen oder was auch immer, ist mir vollkommen gleichgültig.
Leseprobe Sachbuch
Gerd Umhauer
Bosse im alten Europa
Business und Abenteuer von der Antike bis zur Renaissance
Dieses Buch handelt von Abenteuern, die in kaum einem Geschichtsbuch vorkommen, und dennoch die Welt bestimmten. Und es handelt von Menschen, die sie inszenierten und bestanden. Mit einem großen Unterschied: Nicht fremde Territorien waren das Ziel, sondern Herausforderungen zu bestehen, geistigen Ruhm zu erlangen oder einfach Geld zu scheffeln. Zu allen Zeiten und in allen Kulturen gab es Menschen, die sich einfach als Tatendurstige durchs Leben schlugen und dabei Heere anführten, Kreuzzüge organisierten, Friedensverhandlungen führten oder Wirtschaftsimperien schufen. Ich habe mich auf die Taten und Leistungen jener "Alten" konzentriert, die vor Jahrhunderten und Jahrtausenden absichtlich oder zufällig "Unternehmen" schufen und leiteten, die eine gewaltige wirtschaftliche Bedeutung erlangten, wie etwa die Beispiele einiger Weisen und Sophisten im antiken Griechenland, einiger Römer, und der Medici. im Mittelalter zeigen. Ob es sich dabei um Firmen im heutigen Sinne oder einfach um herausragende Unternehmungen handelte, ist den unterschiedlichen Zeiten entsprechend zweitrangig. Die Namen dieser Tatendurstigen sind verewigt, doch ihr Abenteurertum ist eher unbekannt, obwohl man sich seiner Faszination kaum entziehen kann.
Als Nachfahren der berühmten Rhapsoden aus dem Griechenland des 8. bis 6. Jahrhunderts v. Chr., die gelegentlich göttergleiche Bedeutung für die alten Griechen erlangten und teilweise schon zu Urzeiten als fahrende Sänger ihren Lebensunterhalt verdienen konnten, gelangten die Sophisten in der Antike des klassischen Griechenland nicht nur zu Ehre und Ruhm, einige von ihnen, vor allem Protagoras und dessen Schüler Gorgias, entpuppten sich gar als regelrechte Geldscheffler, die Tausende von Anhängern mobilisierten.
Zu den mächtigen und superreichen Bossen aus der alten Zeit gehört auch der Zeitgenosse und Freund Caesars, der römische Tycoon Marcus Crassus, der unter anderem dafür sorgte, dass Caesar, der zeitweise zu den am höchsten verschuldeten Römern zählte, zu Anfang seiner politischen und militärischen Karriere wirtschaftlich überleben konnte.
Ein Unternehmer ganz anderer Sorte war der legendäre Sklavenführer und Gladiator Spartacus, dessen „Geschäftszweck“ darin bestand, für Freiheit und Leben von Sklaven zu kämpfen und zu sterben. Im frühen Mittelalter gehörte der englische König Wilhelm der Eroberer, dessen geschäftliche Begabung seinem Glanz als Staatsschöpfer nicht nachstand, ebenso zu den Superstars des Business wie jene Dogen von Venedig, die um 1200 die italienische Schiffahrt revolutionierten.
Das 13., 14. und 15.Jahrhundert stand besonders im Banne oberitalienischer und deutscher Kaufmanns- und Bankiersfamilien, wie den Florentinern Bardi, Peruzzi, Donati, Albizzi, Pazzi, Strozzi und Medici, den norddeutschen Hanseatenhäusern, der Ravensburger Handelsgesellschaft, damals das bedeutendste Unternehmen auf deutschem Boden, den Augsburger Patriziersippen der Meuttings, Hämmerlins, Öhems, Rehms und natürlich der Fugger. Es ist heute kaum zu ermessen, welchen Einfluss, welche Macht und welchen Reichtum etwa die Medici in ihrer Blütezeit im 15. Jahrhundert, etwa hundert Jahre vor der Konsolidierung der Weltmacht der durchaus konkurrierenden Fuggerfamilie, inne hatten. Giovanni di Bicci de´ Medici und dessen Sohn Cosimo galten damals als die reichsten, einflussreichsten zugleich angesehensten Bürger der Stadt, deren Einfluss auch auf die Künste und die Wissenschaften den Begriff des Mediceischen Zeitalters prägte. Ihren Reichtum verdankten sie den internationalen Handels- und Bankgeschäften zu einer Zeit als nur die primitivsten Kommunikationsmittel existierten und das Finanzwesen gerade so weit entwickelt war, dass man mit dem bargeldlosen Instrument des Wechselbriefes umzugehen lernte.
Diese Urgesteine des alten Europa waren Abenteurer und Überlebenskünstler eines besonderen Schlages. Strotzend vor Charakter wirkten sie wie Tornados und Taifune auf ihre Zeitgenossen. Die meisten waren philosophisch geschult und gedrillt wie ein Protagoras, Sokrates oder Perikles und nicht selten sogar noch strategisch denkende und kämpfende Feldherrn, die es mit einem Pompeius oder Lord Nelson aufnehmen konnten. Der Kontrast zu heutigen Eliten aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung könnte nicht größer sein. Gerade das hat mich am meisten fasziniert, leiden wir doch an einer Zeit, in der vielerorts Möchtegern-Cowboys, Blender, Karriere-Workaholics und charakterlose Gesellen höchste Stellen innehaben. Meistens Figuren, die unter den rauen Bedingungen des Altertums oder gar des Mittelalters allenfalls als Tyrannen, Gaukler oder Giftmischer vorübergehendes Aufsehen erregt hätten.
Obwohl es vor zweieinhalbtausend und auch noch vor fünfhundert Jahren im alten Europa unvergleichlich härter, unfreier, rechte- und gesetzloser, in vieler Beziehung „schlimmer“ zuging als heute, finden sich genug Beispiele dafür, dass zumindest die Eliten ein höheres zivilisatorisches Niveau besaßen als so manche Pseudobosse und Spitzennieten heutzutage. Schon zu Zeiten Spartas und der griechischen Polis und erst recht im sogenannten finsteren Mittelalter finden sich durchgebildete Charaktere zuhauf, die sich nicht nur in den guten, sondern auch unter den schlimmsten Lebensbedingungen zum eigenen und zum Vorteil ihrer Gruppe zu behaupten verstanden, wie wir es sonst nur noch im Tierreich, bei Wölfen, Gorillas, Ratten oder Zugvögeln kennen.
Anstelle der freiheitsbesessenen Barbarei des späten 20. Jahrhunderts, in der die seit Jahrtausenden geltenden Standards grundlos außer Kraft gesetzt scheinen, findet sich im alten Europa noch jene undurchdachte, aber daher instinktive Urwüchsigkeit vor, die uns Menschen intuitive Verhaltensmuster, Orientierung und Sinn verleihen. Darauf beruhen schließlich die abendländischen Ethiken und Sinninterpretationen. Die meisten individuellen und sozialen Werte und Normen, die die früheren Eliten, soweit wir es wissen, wie Götter leiteten, sind verfallen oder seit langem pervertiert. An ihre Stelle sind außer einer Vielzahl von immer neuen Rechtsnormen hauptsächlich Wertvernichtungen, also Entwertungen getreten, mit der Folge einer von weitgehend „leerer“ Freiheit wuchernden Individualitätszivilisation, an deren Ende diesmal nicht Kriege wie in Hellas, Rom, Venedig oder Florenz stehen, sondern eher die Vernichtung der Lebensgrundlagen der Natur.
Niemand kann heute so recht sagen, wie man die unzähligen Probleme allein in den entwickelten Staaten überhaupt wird lösen können und weshalb wir uns immer unaufhaltsamer der Schreckensvision annähern, den herrlichsten und fruchtbarsten aller Planeten zu verheeren und unbewohnbar zu machen. Eines ist allerdings sicher: Ohne uns selbst zu „erneuern“, ohne einen radikalen Kurswechsel in unseren Einstellungen und Haltungen, in unserer geradezu potenzierten Ansprüchlichkeit auf die Maximierung von Freiheit, Geld und Konsum, wird sich nichts zu unserem Schutz und zur Erhaltung der Natur erreichen lassen. Da wir diesbezüglich alle im selben Boot sitzen, ist es spannend und informativ zugleich, sich an die Rhapsoden und Sophisten in der archaischen Zeit, an die großen Zeiten im alten Rom und im Florenz der frühen Renaissance zu erinnern und einige „Abenteurer“ dieser Epochen zu durchleuchten, die uns wichtige, manchmal philosophische Orientierungen vermitteln können.
In der Geschichtsschreibung und Literatur findet man fast nur Berichte von Menschen, die sich in der politischen, militärischen, künstlerischen und wissenschaftlichen Arena einen Namen machten. Über ausgeprägte Businesstypen, die mit voller Kraft im Leben standen, gibt es wenige Quellen. Ich bin den Spuren jener Bosse im alten Europa gefolgt, die etwas zustande brachten, auch wenn sie Sklavenführer oder „Weise“ waren, und habe herauszuarbeiten versucht, was sie innerlich bestimmte und leitete. Dabei stellten sich überraschend Charaktertypen heraus, die wir heutzutage als Abenteurer bezeichnen würden, deren Triebfedern und Selbstverständnis jedoch andersartig war. Das ist kein Wunder, denn Abenteuergeist in unserem heute verstandenen Sinne existierte ja noch lange nicht.
Welche Rolle spielte eigentlich Erfolg? Welche Werte und Normen leiteten die Tatendurstigen die etwas zustande brachten, welche Philosophie lenkte sie? Ein interessantes Ergebnis dieses Buches lautet: Typen, die vielleicht ohne es zu wissen, Abenteurer waren oder einfach Abenteurereigenschaften besaßen, hatten den Erfolg geradezu gepachtet. Überraschend außerdem: Nicht wenige alteuropäische Bosse waren regelrechte Intellektuelle und besaßen so etwas wie eine Philosophie, die ihr Leben und Handeln bestimmte. Solon, der Weise, war Verfassungsschöpfer, Rechtsgelehrter, Staatsmann, Feldherr, Dichter und Kaufmann; Protagoras von Abdera, der die Menschen durch seine Redekunst in den Bann zog wie heutige Rockstars die breite Masse, war Philosoph, Begründer und Vertreter der Sophistik; der gefeierte Gorgias von Leontinoi, ebenfalls einer der großen Sophisten, wurde als Abgeordneter seines Landes zu Friedensverhandlungen im Peloponnesischen Krieg entsandt, weil kein anderer wie er alle und jeden zu überzeugen verstand; der als schier unbesiegbar geltende Iason von Pherai entpuppt sich nicht nur als großer Feldherr, kampferprobter Krieger und Herrscher seines Volkes, sondern auch als glanzvoller Redner und Sophist; in dem römischen Tycoon Marcus Crassus, der im alten Rom ein Wirtschaftsimperium geschaffen hatte, begegnen wir gar einem Vertreter der wichtigsten philosophischen Ethik des Altertums, der Stoa, und wer weiß schon, ob es gerade dieses philosophische Credo war, das den Superreichen noch als Sechzigjährigen in den Krieg im fernen Asien zog.
Die Beweggründe von Menschen, die im Laufe ihres Lebens nach großen Taten, Macht oder wirtschaftlicher Bedeutung strebten, ähnelten sich in allen Zeiten. Viele sind von der Lust auf Macht oder Ruhm, Besitz oder Geld getrieben, andere werden von bloßer Gier, vom Drang nach Anerkennung oder der Einbildung ihrer Berufung bestimmt. Königinnen und Kaiserinnen, Staatsmänner, Fürsten und Herrscher machen ebenso wenig eine Ausnahme wie Kirchenoberhäupter, Handelsbarone, Kreuzritter, Filmstars oder Rockidole. Während diese Motive tatsächlich jahrhunderte- oder gar jahrtausendealt und in allen Kulturen beherrschend sind, scheint die Triebfeder der Abenteuerlust eine Errungenschaft der Moderne zu sein.
Bei keinem der großen griechischen Geschichtsschreiber taucht dieser Beweggrund als solcher irgendwie auf. Weder Herodot, dem schon im Altertum der Ehrenname "Vater der Geschichte" verliehen wurde, noch Thukydides oder Xenophon, die im 5. Jahrhundert v. Chr. immerhin schon sparsame Charakteristiken großer Griechen wir Agesilaos, Themistokles, Perikles, Nikias, Alkibiades in ihre Kriegsberichterstattungen einfügten, findet sich solch ein Motiv, obwohl die Ereignisse des Peloponnesischen Krieges, über die Thukydides berichtet, oder des großen Feldzuges des Kyros gegen Artaxerxes oder des Spartanerkönigs Agesilaos gegen die Perser und Griechen, den Xenophon beschreibt, wohl mehr mit Abenteuer zu tun haben, als jede Expedition zum Nordpol. Nicht einmal bei Plutarch, dem vielleicht bekanntesten unter den Geschichtsschreibern, der über viele bedeutende Griechen und Römer Biographien verfasste, findet sich ein Hinweise oder eine Erwähnung der Abenteuerlust als Motiv zu großen Taten.
Taten sind jedoch nicht davon abhängig, welche Motive uns dazu bestimmen. Pyramiden und Tempel wurden gebaut, ohne dass es eines Berühmtheits- oder Ewigkeitsmotives bedurfte. Als die drei Venezianer Niccolo, Matteo und Marco Polo sich im Jahre 1271 auf den Weg in den Orient über die berühmte Karawanenstraße machten, auf der die kostbaren Seidenwaren in den Okzident gelangten, hatten sie viele Triebfedern, nur eine nicht: sich in ein Abenteuer zu stürzen, von dem sie erst ein Vierteljahrhundert später auf den Rialto zurückkehrten. Und doch sind sie so etwas wie der Inbegriff der Abenteurer für uns geworden, denen noch heute junge Menschen auf der ganzen Welt nacheifern.
Niemand muss also mit dem Vorsatz antreten, ein Tycoon zu werden, um besondere Taten zu vollbringen oder Bedeutung zu erlangen. Es zeigt sich aber, dass die Unbekümmertheit, der bloße Drang, der Mut, das Nicht-rückwärts-und-nicht-vorwärts-Schauen beim Durchqueren des Lebensdschungels mitunter die besten Voraussetzungen für erfolgreiche Missionen bieten, also mit durchbruchartigem Erfolg belohnt werden. Allesamt Abenteuereigenschaften.
Nebenbei hat es mich interessiert, herauszuarbeiten, was Wirtschaft in den zweitausend Jahren zwischen dem 8 Jh. v. Chr. und dem 15 Jh. n. Chr. bedeutete, denn in unserem heutigen Sinne gab es damals noch keine Wirtschaft. Modern ausgedrückt: Welche Wirtschaftsstrukturen waren in der archaischen, antiken, hellenistischen, römischen Epoche und welche im Mittelalter vorherrschend?
So handelt der erst Teil des Buches von der archaischen und antiken Zeit und ihren Bossen, der zweite Teil von der hellenistischen Zeit bis zum Beginn der römischen Weltmacht. Der dritte Teil schildert in Umrissen die soziale, politische und wirtschaftliche Struktur in Rom und dem römischen Reich. Dabei habe ich versucht, die Voraussetzungen und Bedingungen zu verdeutlichen, unter denen ein Magnat wie Crassus sein Business-Imperium schaffen konnte und welche Fähigkeiten und Eigenschaften diesen Big Boss des alten Rom auszuzeichnen schienen. Im Kontrast hierzu sind die Taten des Sklavenführers Spartacus hervorgehoben, eines authentischen Helden, der die Weltmacht Rom das Fürchten lehrte.
Im vierten Teil bin ich den Spuren der modernen europäischen Wirtschaftsgeschichte, d.h. den Voraussetzungen für die spätere industrielle Revolution nachgegangen, deren Wurzeln etwa zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert gelegt wurden. Daran schließt sich die Entwicklungsgeschichte der ersten Business-Superstars des Mittelalters an, des Giovanni und des Cosimo de` Medici.
Leseprobe
Gerd Umhauer
Zum Heulen und Vergöttern
Kurzgeschichten
Fahre nachmittags kurz zu Hause vor- bei, um ein paar Sachen zu packen, als mich eine junge Frau anspricht, die rechts neben meiner Wohnungstüre sitzt und aufsteht, als ich die Treppe hoch- komme.
„Hallo Herr Reiners, ich bin Anita Kendel, vielleicht erinnern Sie sich, Sie haben mich vor gut einem Jahr zu zehn Tagessätzen à 50 Euro verurteilt und mir nach der Verhandlung das Geld aus eigener Tasche geschenkt.“
Spontan gebe ich ihr die Hand. „Wiedererkannt hätte ich Sie wohl nicht, aber natürlich erinnere ich mich sehr gut. Warten Sie denn auf mich?“
Sie nickt. „Darf ich vielleicht zwanzig Minuten mit Ihnen sprechen? Ich habe den ganzen Tag über probiert, Sie zu erreichen.“
„Na dann kommen Sie nur herein.“
Die Frau ist etwa 24, gelernte Bankkauffrau, hatte die Kasse in einer Tankstelle ausgeraubt und ein paar tausend Euro erbeutet. Ich glaubte ihr damals, dass sie von ihrem Freund erpresst wurde, doch es war rechtlich nicht möglich, sie ganz freizusprechen. Weil sie kein Geld hatte und ersatzweise in einem Frauenhaus Dienst hätte leisten müssen, habe ich ihr aus Mitleid anschließend die 500 Euro geschenkt.
„Nennen Sie mich Anita, ich bin so schrecklich froh, dass Sie sich Zeit nehmen.“
Wir setzen uns in mein häusliches Büro, trinken Kaffee aus der Thermoskanne, der noch annehmbar warm ist.
„In der Klemme sitzt du aber nicht, oder doch, Anita?“, frage ich in dunkler Vorahnung.
„Ich habe nichts mehr Kriminelles gemacht, wenn Sie das meinen, aber ich stecke in einer anderen Klemme, aus der ich Angst habe, nicht wieder allein herauszufinden. Ich dachte, Sie können mir vielleicht moralisch irgendwie weiterhelfen, schon so ein Gespräch gibt mir viel, ich kenne niemanden wie Sie, seit meine Tante tot ist.“
„Erzähl mal“, fordere ich sie auf.
„Dass Sie mir damals einfach so das Geld geschenkt haben, hat mir unglaublich geholfen, mich aus meinem Sumpf herauszuarbeiten, weil ausgerechnet ein unbekannter Richter Vertrauen zu mir hatte. Ich habe sofort mit meinem Freund Schluss gemacht, bin abgehauen zu meiner Tante aufs Land, wo er mich nicht finden konnte, aber Tante Gudrun, die Volkswirtin war, ist letzte Woche gestorben.“
„Oh“, mache ich und erinnere mich, dass ihre Mutter wohl Alkoholikerin war und der Vater nicht mehr lebt.
„Sie können sich sicher vorstellen“, fährt sie fort, „dass keine Bank, keine Versicherung, kein Finanzdienstleister mich mehr beschäftigen will, und sonst habe ich nur Drecksstellen gefunden, wo ich auf die eine oder andere Weise angemacht oder bedroht wurde und wieder verschwinden musste.
Der Sozialarbeiter, den ich eine Zeitlang hatte, war keinerlei Hilfe, weil er mir auch nur an die Wäsche wollte. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, will aber nicht zu den öffentlichen Stellen und Sozialhilfe oder Hartz IV beantragen, weil ich wirklich was leisten kann und mein Geld selbst verdienen möchte. Ich finde zurzeit mal da und dort Unterschlupf und Aushilfsarbeiten. Bei meiner Mutter kann ich nicht bleiben, dort bin ich nicht sicher, weil sie dauernd Männer bei sich wohnen lässt.“
Sie guckt so drein, als ob sie sich entschuldigen müsste.
„Ich dachte, wenn ich mit Ihnen ab und zu reden könnte, vielleicht auch mal um Rat fragen, quasi als moralische und verbale Anlaufstation, würde mir das sicher den Mut geben, mein Leben wieder in die Hand zu nehmen. Irgendwie finde ich schon was, wo ich mich bewähren kann, aber so allein auf mich gestellt, fressen mich Angst und Verzagen noch auf.“
Leseprobe Sachbuch
Gerd Umhauer
Lernabenteuer als Erfolgs- und Glücksstrategie
Reportagen, Experimente,Forschung
In früheren Reportagen und Recherchen über die Erfolgreichen und die Supererfolgreichen bin ich eher zufällig Menschen begegnet, die ein Abonnement auf Lebensglück zu besitzen scheinen. Zuerst habe ich es übersehen. Und das hatte Gründe. Diese Menschen sind nämlich beseelt. In einem fort können sie Selbstmotivationen erzeugen, stark genug sie anzufeuern, tolle Gefühle hervorzurufen und entsprechende Befriedigung über ihren lustvollen Tatendrang zu erreichen, aber sie wissen es oft selbst nicht oder reden ungern davon, wenn überhaupt. Dabei scheinen solche Motivationskaskaden zu funktionieren wie ein Perpetuum mobile des Glücks.
Weder bedienen sie sich fernöstlicher Meditationsmethoden noch eifern sie antiken Glücksvorstellungen wie denen des Epikur oder der Stoa nach, sondern sind eher unscheinbare Zeitgenossen, die hochwirksame Glückspillen schlucken, die sie durch ihre Erfolgsmaschen oder Glücksdrehs selbst erschaffen. Offenbar sind sie unbewusst imstande, mit Hilfe der eigenen inneren Drogenapotheke am laufenden Band tolle Gefühle und lustvolle Antriebsenergien zu erzeugen.
Mehr und mehr begann ich mich für solche Lebenselixiere zu interessieren, die jenseits von purem Erfolgsdenken und -handeln Herz und Seele erfüllen. Was sind das für ominöse Maschen, die da praktiziert werden und ein Leben zu einem vielversprechenden Abenteuer machen? Welche geheimnisvollen Drehs ermöglichen es, Motivationen gleichsam nonstop zu produzieren und dabei Lust und Freude zu vermitteln? Wie generiert man, anders gefragt, unentwegt Antriebsenergien und kann dabei euphorisch sein, und zwar nicht nur einen Tag, ein Wochenende, einen Urlaub lang, nein jahre-, ja jahrzehntelang?
Dass sich das ganze Geheimnis hinter etwas Altbekanntem versteckte, nämlich in Lernabenteuern, wenngleich in außergewöhnlich raffinierter Verpackung, ahnte ich lange nicht.
Zum Beispiel fand ich Leute mit fortwährenden zwölfstündigen Arbeitsräuschen, die sie wie Freudenfeste erleben und ausnützen (Kap. 2). Ich stieß auf eine 52-jährige Frau, die nicht nur eine Jugendlichkeitsdroge zu besitzen scheint, (sie sieht aus wie höchstens dreißig), sondern die sich auch noch einem regelrechten Lernenthusiasmus verschrieben hat, der ihr eine Art Dauerglück verheißt (Kap. 3).
Je länger ich recherchierte, desto mehr kam zum Vorschein, dass wohl jeder, der aktiv mit etwas zu Werke geht, dauerhafte Hochstimmungen selbst erzeugen kann. Das aktive eifrige Beschäftigen mit etwas Interessantem dürfte eine Voraussetzung sein, und das Wissen um Katalysatoren und einige wichtige Erkenntnisse aus der neurobiologischen Forschung am Gehirn helfen ganz entscheidend.
Aus den Storys der Menschen, mit denen ich sprechen konnte, kristallisierten sich nämlich erlebnishafte Auslöser für Dauermotivationen heraus. Solche Katalysatoren können Interessen, Prägungen, Visionen, verrückte Ideen, aber auch Ängste oder persönliche Pein sein, so wie bei einer Chemiestudentin, die jahrelang mit ihrem Körper laborierte. Sie beschloss im Urlaub kurzerhand, das gesamte komplexe Handwerkszeug der chinesischen Akupunktur zur Selbstbehandlung wie einen Sport zu erlernen, um sich selber helfen zu können, wo und wann es nötig war. Das war die Initialzündung in ihrem Leben, die schöne Gefühle geradezu wuchern ließ und lässt (Kap. 4).
Legt man die modernen Erkenntnisse aus der neurobiologischen Forschung zu Grunde, so ergibt sich ein geradezu sensationeller Tatbestand: Lernen im weitesten Sinne ist ganz eng mit unserem gehirninternen Belohnungssystem verbunden. Man kann auch sagen, unsere Riesenmasse an grauen Zellen ist eine Lust- und Motivationsmaschine, die uns fortwährend gute Gefühle schenkt, wenn wir uns in Lernprozesse stürzen und das Gehirn beschäftigen. Vielleicht gerade weil unser Geist so ungeheuer leistungs- und speicherfähig ist, hasst er den Zustand des Nicht-Lernens, der ätzenden Langeweile in seinen unendlichen Neuronennetzen umso mehr (Anhänge 1, 2, 3).
In Teil 2 habe ich über zwei Jahre hinweg mit drei Teilnehmern gleichsam ein „Lern-Glücks-Experiment“ durchgeführt. Da unser Gehirn so beschaffen zu sein scheint, dass durch simples Lernen Hochgefühle erzeugt werden, die sich mit denen von Verliebten vergleichen lassen, wollte ich eine Art Probe aufs Exempel machen. Drei Studenten haben sich an einem Projekt beteiligt, das sehr lern-, kommunikations- und zeitintensiv war und zu verwertbaren Ergebnissen führen sollte. So sollten unsere „Gehirne“ zwei Jahre lang (und darüber hinaus) mit Extraportionen euphorisierender Antriebsenergien gefüllt werden. Lesen Sie selbst.
Mitzuerleben, wie Frauen und Männer energiegeladene, themengebundene Hochstimmungen sozusagen nonstop produzieren, die sie erfolgreich machen, ihrem Leben Sinn und Bedeutung verleihen und nicht enden wollende Befriedigungsgefühle nach sich ziehen, kann süchtig machen. Denken Sie daran, bevor Sie lesen!
Leseprobe Kinder-und Jugendbuch
Gerd Umhauer
Das Bettelmädchen und der indische Gott
Gerade als die ersten Sonnenstrahlen hinter dem Horizont hervorkamen, bemerkte Sudha weiter vorne eine Schar Geier, auf die das spärliche Licht fiel. Das war nichts Außerge-wöhnliches hier draußen, hätten sie nicht eine Art Kreis gebildet. Außerdem waren es viele, mindestens acht oder neun und es sah bedrohlich aus.
Menschen taten die großen nützlichen Tiere eigentlich nichts, das wusste die Neunjährige und näherte sich voll klammer Neugier. Die grau-weißen und aschbraunen Vögel zuckten sichtbar, verharrten aber in ihrer Aufstellung, als warteten sie darauf, bis ihr Opfer verendete.
Das Mädchen, das nicht viel mehr als einen Kopf größer war als die aufrecht stehenden Aasfresser, brachte Unruhe in die Tiere. Als zwei der großen Todesvögel einen halben Meter zur Seite sprangen, als ob sie einen besseren Platz suchten, sah Sudha ein Bündel vor ihnen auf der Erde liegen, das sich bewegte. Die ausgetrocknete Erde unter dem Müll war nahezu schwarz.
Instinktiv spannte sie ihr dunkelrotes Sarituch fester und zögerte. Nie zuvor war sie Geiern so nahe gekommen oder hätte gar gewagt, sich einer solchen Ansammlung der angsteinflößenden Greifvögel zu nähern, doch sie war sich beinahe sicher, dass es ein Kind oder ein Baby war, das im Sterben lag. Ihre Aufregung war so groß, dass sie den Fäulnisgestank auf der Abfallhalde überhaupt nicht mehr wahrnahm.
Ihre Augen waren gebannt auf die Stofffetzen gerichtet, in die das kleine Lebewesen eingewickelt war. Vor lauter Anspannung spürte sie jeden einzelnen Stein unter ihren Zehen. Als der vorderste Geier plötzlich sein mächtiges Gefieder geräuschvoll aufschwang, erschrak sie heftig. Er flog aber nicht weg, sondern sprang nur zur Seite.
Das dunkle Bündel lag im Schatten der Vögel, sonst hätte sie besser erkennen können, ob es tatsächlich ein kleines Kind war. Geier waren immer zur Stelle, wenn ein Lebewesen zur Erde fiel und lauerten auf den Tod, sogar bei den heiligen Kühen machten sie keine Ausnahmen, das hatte sie schon öfter beobachtet. Wäre das Wesen da vorne schon tot oder schwer verletzt gewesen, würden sie nicht nur herumstehen, sondern auf ihm herumhacken, dachte sie, und das machte ihr Mut, vorsichtig weiter zu gehen.
Laut um Hilfe zu schreien oder mit den herumliegenden Gegenständen nach den Vögeln zu werfen, traute sie sich nicht. Sie hatte Angst, dass sie ihre Beute dann mit ihren langen Schnäbeln schnappten und mit sich fortrissen.
Nur einer, dann ein zweiter der mächtigen Geier wich springend etwas zur Seite, als Sudha noch näher kam. Nach wie vor konnte sie nichts richtig erkennen, es war alles grau in grau. Und die ersten Sonnenstrahlen, die gerade zum Vorschein kamen und auf die Geier fielen, warfen Schatten. Am liebsten hätte sie jetzt ihre Mutter zu Hilfe geholt, aber die war schon viel zu weit entfernt.
Als sie beinahe Seite an Seite mit den großen Vögeln war, die sie anscheinend respektierten, hoffte sie darauf, dass sich das eingewickelte Bündel wieder bewegte. Innerlich bebend rief das Hindumädchen leise: „Kannst du mich hören?“, doch ihre Stimme versagte und ein ratterndes Geräusch von der entfernten Straße übertönte alles.
Da die Geier nicht gefährlich reagierten, sondern stur verharrten, legte sich Sudhas Angst ein wenig, dass sie ihr etwas tun würden. Augenblicke später, der Straßenlärm war in der Ferne verklungen, bemerkte sie eine Bewegung, wahrscheinlich war es ein Fuß. Durch die Neunjährige ging ein heftiger Ruck. Sie duckte sich wie zum Schutz, sprang regelrecht hin, bückte sich auf den Boden und sah, dass es ein Kind war.
Es lebte, das sah sie sofort, als es fast erstaunt die Augen aufschlug. Beider Blicke kreuzten sich. Es war, als ob das kleine Wesen sie anlächelte. Es ging ihr durch und durch. Wie in Trance packte sie das schmutzige Bündel und wollte einfach weglaufen, doch es entglitt ihr. Ihre Hände waren zu nass vom Angstschweiß und das Kind war schwerer als es aussah.
Angstvoll drehte sie sich nach den Geiern um. Einige hüpften bedrohlich näher. Sudha krallte ihre Fingernägel in den zerschlissenen Stoff und konnte das Kind unter ihren rechten Arm packen. Diesmal passte sie auf, dass sie es halten konnte, schnellte aus der Hocke hoch und lief davon.
Erst als sie sicher war, dass die Geier sie zwischen den Müllansammlungen nicht verfolgten, hielt sie inne, kauerte sich auf den Boden, um zu verschnaufen. Ein unbeschreiblicher Gestank machte ihr das Atmen schwer, aber das Kind in ihrem Arm sah sie aus großen Augen an, fast reglos, so dass sie Angst bekam, es könne sich vielleicht nicht mehr recht bewegen oder habe Lähmungen.
„Hallo“, sagte sie, „ich heiße Sudha, und wie heißt du?“
Leseprobe Roman
Gerd Umhauer
Zombies, Lungenkrebs und Barbarella
Report über die neue Glücksseligkeit
Roman, 2016
Endlich wieder in Freiheit! Nachdem ich schon
in fünf Ländern verhaftet wurde, wird es immer
schwieriger, meine Arbeit zu machen.
In Indien kam ich nur mit Hilfe des Maharadschas
von Udaipur wieder frei, der den Bezirksrichter
endlich davon überzeugen konnte, dass man
Elefanten nicht bestechen kann, wie mir vorgeworfen
wurde. In London ließ mich der britische Geheimdienst
wegen meiner Enthüllungen über die unverschämten
Profite der englische Finanzindustrie an der Rettung
des Euro verhaften, und nur dank des aufopfe-
rungsvollen Einsatzes der Queen kam ich nach
drei Tagen wieder auf freien Fuß.
In den USA hat mich ausgerechnet die Be-
spitzelungshochburg NSSSA vor dem langjährigen
Knast bewahrt, weil ich ihnen meinen geo-
politischen Einfluss zur Festigung ihrer Weltmacht-
position gegenüber China und den Schwellenländern zusichern konnte. Das ging gerade noch
mal gut.
Die amerikanischen Sicherheitsspezialisten, die ja nicht nur unsere Kanzlerin überwachen,
sondern auch die Elefanten in Indien, die Krokodile im Nil, Koalas in Australien, ja sogar
unseren Wunderhengst Totilas, der jetzt in Pension gehen darf, zählen natürlich jetzt
voll auf mich und meine geopolitische Rolle.
In der altehrwürdigen Schweiz hingegen half gar nichts. Nicht einmal der allmächtige
Einfluss des größten Fußballverbandes aller Zeiten und deren Management.
Ein Schweizer Gefängnis ist natürlich komfortabler als ein mexikanisches oder gar
indisches, aber die Freiheit ist so oder so hops. Die Kantonsbehörde wirft mir vor,
das Schwyzerdütsch germanisieren zu wollen und fürchtet natürlich mit Recht meinen
geopolitischen Einfluss, also genau das, was die amerikanische Sicherheitsbehörde bejubelt.
Dort entkam ich aus dem Kantonsgefängnis nur rein zufällig durch einen Tunnel,
den Schwerverbrecher vor Jahrzehnten schon gegraben hatten und der dermaßen
verstaubt war, dass man ihn übersehen hatte. Folglich bin ich immer noch
auf der Flucht und habe jetzt Angst, dass die Kantonsbehörde meine Auslieferung
verlangt.
Leseprobe - Kinder- und Jugendbuch
Gerd Umhauer
Wenn Hänsel und Gretel philosophieren
Roman über Abenteuer im Kopf
„Was versteht man unter philosophieren?“, will die 11-Jährige wissen.
Ihre Tante lacht. „Tja, das kann ich nicht mal selber erklären, Jutta. Auf jeden Fall heißt es denken. Und zwar so, dass man sich und die Welt besser verstehen lernt. Was ganz Tolles!
Und es macht gar nichts, dass man es nicht recht erklären kann“, fügt die Tante hinzu. „Die Liebe kann man auch nicht erklären, aber sie ist wichtiger als fast alles andere.“
„Meinst du, wir verstehen das?“, fragt Juttas Bruder besorgt. „Sophies Vater, ist ein Zauberer, Michael“, sagt die Tante lachend. „Er überlegt sich immer Geschichten, wie er der kleinen Sophie, die noch nicht einmal fünf ist, schwierige Dinge verständlich machen kann. Einen besseren Lehrer könnt ihr gar nicht haben.“
… „Ich hab heute so hingeschrieben: Wo kommen die Wörter her?“, erkläre ich. „Können Sie mir erklären, wo die herkommen?“
„Schwierige Frage“, sagt Frau Kister.
Dann überlegt sie. „Es ist so, als wenn du fragst, wo kommen die Schachzüge her. Was genau interessiert dich an den Wörtern, Jutta?“
„Wenn ich Gedanken aufschreibe, kommen die Wörter in den Sinn. Ich muss mich nur konzentrieren und warten. Abrakadabra sind sie da.“
Frau Kister lacht.
„Als du klein warst, hast du angefangen, sprechen und verstehen zu lernen. So hast du mittlerweile zehn bis zwanzigtausend Wörter gelernt, schätze ich mal, die im Gedächtnis mehr oder weniger gut gespeichert wurden. Von dort kommen sie also her, aber auch aus dem, was du sagen willst, aus dem Denken und Wollen, würde ich vorsichtig sagen. Habe über die Frage selber noch nie nachgedacht, fällt mir jetzt ein.“
Sudle Frau Kisters Erklärung schnell in mein Notizbüchlein. Lilly schreibt es auch auf.
„Dann kommen die Schachzüge ja auch aus den Dreien“, murmle ich, „aus dem Gedächtnis, dem Denken und Wollen. Cool!“
„Das Ganze nennt man dann Können“, sagt Frau Kister lächelnd. „Sprechen, Verstehen, Lesen, Schreiben, Denken, Schachspielen können.“
Das Wort Können umrahme ich natürlich fünfmal.
„Du hast gesagt, du schreibst Gedanken auf. Wie machst du das, Jutta?“, will Frau Kister wissen.
Ich lache.
„Das ist so wie beim Schachspielen. Ich ziehe einfach so, wie ich die Partie sehe. Die Gedanken, die ich aufschreibe, sind meine Züge.“
„Sehr kreativ“, lobt sie.
„Dafür habe ich seit dem Philosophieren beim Professor ein Extra-Heft angelegt. Alles mit Bleistift, damit ich ändern kann. Heute Abend schreibe ich was übers Verstehen rein. Sie haben mich vorhin draufgebracht, weil Sie sagten, dass zum Sprechen ja Verstehen gehört. Hab ich noch gar nie dran gedacht. Bestimmt fang ich mit dem Satz an, ‚wo kommt das Verstehen her‘?“
Frau Kister lächelt und streicht mir übers Haar. „Du bist ein erstaunliches Mädchen, Jutta.“
Leseprobe - Niemandsland der Gefühle
Gerd Umhauer
Niemandsland der Gefühle
Kurzgeschichten
Als ich von der Autobahn ins nächtliche München abbiege, ist es erst 23 Uhr 40. Macht gute Laune trotz des langen Arbeitstags. Andere Leute setzen sich ins Flugzeug, ich fahre lieber Auto.
Überlege, ob ich Evi noch anrufen und was Versöhnliches sagen soll. Wir haben Knatsch, weil sie fremdgegangen ist. Verwerfe es dann wieder. Will es lieber bei einer Umarmung tun.
Beim Aufschließen der Wohnungstüre laute Musik. Was ist da los? Werde erst unruhig und dann ärgerlich, noch bevor ich sehe, dass die Garderobe zugehangen ist mit Jacken und Schals. Drei Schirme stehen im Ständer.
Die Türe zum Wohnzimmer steht offen. Evi tanzt mit einem Typ, den ich noch nie gesehen habe. Eine seiner Hände ist auf ihren Po gepresst. Ein weiteres Pärchen auf dem Sofa knutscht, kenne die Leute ebenfalls nicht. Niemand bemerkt mich in dem Musikgedudel.
Werde so von Wut und Enttäuschung übermannt, dass ich nur noch agiere, den Tänzer an den Haaren von Evis Hals nach hinten reiße und mit dem Knie in den Magen trete. Er krümmt sich, ächzt, fällt hin. Evi schlage ich ins Gesicht, bevor sie reagieren kann und schreie das unbekannte Paar an, auf der Stelle meine Wohnung zu verlassen.
Meine Freundin guckt mich aus verlorenen Augen an. Sie ist alkoholisiert, der Typ am Boden wohl auch, denn er kommt kaum hoch, wankt davon. Ich schleife ihn am Hemdkragen in den Hausflur. Er ist schon älter, schütteres Haar, wirkt verängstigt.
„Verschwinden Sie, und zwar plötzlich“, drohe ich, schreie aber nicht mehr. Irgendwie tut er mir leid, wirkt hilflos.
Die beiden anderen, Mitte 30, sie blond, lange Haare, wild geschminkt, er bärtig, Brille, eher schmächtig und ebenfalls berauscht, versuchen zu beschwichtigen, ich sollte mich doch nicht aufregen, sie feierten doch nur. Ich kümmere mich nicht um sie, laufe zu Evi, die sich hingesetzt hat, apathisch wirkt.
„Geht das jetzt so weiter mit dir?“, fauche ich. „Treibst du es jetzt in der Wohnung, wenn ich nicht da bin? Was sind das für Leute?“
Sie gibt keine Antwort. Ich sinke auf die Couch, vergrabe das Gesicht in den Händen. Tränen. Wieder ist alles kaputt…
Leseprobe - Töten üben
Gerd Umhauer
Thriller, ca.190 Seten
Zumindest sah er aus wie ein Jogger. Etwa ein Meter sechsundsiebzig groß, schlank. Schwarze Tights, blauschwarze Funktionsjacke, dunkelblaue Asics-Schuhe. Die tief in die Stirn gezogene Baseball-Kappe, Bart und schwarze Brille machten das Gesicht auch bei Helligkeit unkenntlich. Es war ungefähr zehn Minuten nach drei Uhr morgens in einer dunklen Nacht.
Beim Aussteigen legte er die Brille achtlos auf den Beifahrersitz und joggte unendlich langsam die etwa zwei Kilometer zu einem Bauernhaus, in dem Georg Leber eine Zweitwohnung hatte. In einem der Blumenkästen steckte ein Schlüssel, mit dem er unbemerkt in die Parterre-Wohnung gelangte.
Nur die schwarzen Überhandschuhe streifte der Jogger ab und steckte sie in den Hosenbund. Die dünnen Chirurgen-Handschuhe darunter behielt er an. Warten, bis die Augen an die Dunkelheit gewöhnt waren. Alles blieb ruhig. Er kannte sich aus, war schon mal hier. Alles war im ländlichen Stil eingerichtet. Der Holzboden knarrte manchmal.
Die dunkle Gestalt schlich in den Raum hinten links, dessen Türe offen stand. Schon aus zwei Metern Abstand hörte man das unregelmäßige Schnarcheln des Schläfers. Als der Eindringling neben dem Nachttisch stand, vergewisserte er sich, dass die Buddha-Figur noch an ihrem Platz stand.
Zweimal, nur eine halbe Sekunde lang, ließ er den Strahl seiner kugelschreibergroßen Taschenlampe über den Kopf des Schlafenden huschen. Dieser lag auf der Seite und drehte ihm den Rücken zu.
Roboterhaft umfasste er erst mit einer Hand dann mit beiden die Buddha-Figur. Doch als er sie anhob, um sie auf den Kopf des Mannes zu schmettern, schossen blitzlichtartige Erinnerungen durchs Hirn. Es war wie eine grelle Fontäne mit Bildern aus der Kindheit. Der Horror kam zurück. Sekunden-Visionen kannte man ja, aber das war bizarrer. Dieses Monster, das jetzt hier nichtsahnend schlief, stieß alptraumhaft sein ekelerregendes Genital in die Kinder. Hundert-, nein tausendfach. Gleißende Funkenschwaden durchzuckten die Unterleiber. Qualvolle Erinnerungsfetzen im Schnelldurchlauf. Schlimmer als jeder Alptraum. Je größer die Qualen der kleinen Mädchen desto gewaltiger Wut und Genuss, dieses Monster hier zu zermalmen, zu zerquetschen, so dass es siechte, vegetierte, ätzend langsam dem Tod entgegenkroch. Ich werde dich nicht gleich töten, Georg, hallte eine Stimme durchs Hirn, sondern qualvoll dahin vegetieren lassen. Die neonhellen Strahlen im Hirn zogen sich zurück und beendeten die Erstarrung der Arme und Hände. Ruhe kehrte ins Hirn zurück. Sie war wie ein Befehl.
Den Handteller großen Filzsockel der Buddha-Figur ließ die bärtige Gestalt dann wuchtig auf die Schläfe des Schlafenden herunterkrachen. In der nächtlichen Stille machte es ffflaaa. Ein Zucken. Dann der rechte Arm des Schläfers, der sich auf und ab bewegte. Röcheln. Der Versuch sich zu drehen und aufzurichten.
Doch bevor der Mann im Bett es geschafft hatte, folgte der nächste dumpfe Schlag auf seinen Schädel mit noch größerer Wut und Wucht. Augenblicklich sank er in sich zusammen. Man hörte ein leises Gurgeln. Sonst nichts. Der Eindringling leuchtete alles seelenruhig ab, wie um sich zu vergewissern, dass Georg Leber sich nicht mehr rührte.
Vielleicht zwanzig Sekunden später schlich der Jogger genauso leise aus dem Haus wie er gekommen war und deponierte den Schlüssel wieder im Blumenkasten. Den handgroßen Stein, den er in der Seitentasche seiner Funktionsjacke hatte, falls die Buddha-Figur nicht an ihrem Platz gestanden hätte, legte er irgendwo auf der Erde neben dem Holzstapel vor dem Haus ab. Dann zog er die Überhandschuhe wieder an und joggte zu seinem unweit geparkten Auto zurück.